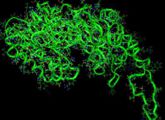Wochenrückblick KW 32
Rückblick auf Kalenderwoche 32
Für den Zeitraum 4. bis 10. August hat biotechnologie.de für Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Biotech-Branche zusammengestellt.
Grüne Gentechnik: Politik wirbt für "ohne", Industrie will nur mit
Während die Politik die Kennzeichnung von gentechnikfreien Lebensmitteln erleichtern möchte, will der deutsche Chemiekonzern BASF in den nächsten Jahren verstärkt auf die Grüne Gentechnik setzen.
Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) hat jetzt in München ein neues Logo "Ohne Gentechnik" vorgestellt. Der Schriftzug über einer dreiblättrigen Pflanze soll die bisher üblichen unterschiedlichen Kennzeichnungen durch ein bundesweit einheitliches Label ersetzen, so die Ministerin auf einer Pressekonferenz am 10. August. Seit Anfang 2008 besteht die Möglichkeit, Lebensmittel mit der Angabe "ohne Gentechnik" zu kennzeichnen (mehr...).
Allerdings wurde in der Praxis diese Kennzeichnung bislang nur zurückhaltend verwendet (mehr...). Das nun von Aigner vorgestellte neue Logo ist in vielerlei Hinsicht strenger als die bisher mögliche Kennzeichnung nach europäischem Lebensmittelkennzeichnungsrecht, wie einem auf der BMELV-Webseite veröffentlichten Informationsbroschüre zu entnehmen ist. Demnach dürfen mit dem neuen Logo versehene Lebensmittel keine Spuren von gentechnisch veränderten Bestandteilen enthalten, die Tiere, aus denen Lebensmitteln gewonnen werden, dürfen in einem bestimmten Zeitraum nicht mit gentechnisch verändertem Futter in Berührung gekommen sein, und auch verwendete Lebensmittelzusatzstoffe, Vitamine, Aminosäuren, Aromen sowie Enzyme dürfen nicht in gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Auch Öko-Produkte sind nicht automatisch berechtigt, das Logo zu verwenden. "Die Kennzeichnung ist noch etwas schärfer als beim Öko-Landbau", sagte der für Gentechnik zuständige Ministerialbeamte Wolfgang Koehler. Umständlich gestalten dürfte sich die Kennzeichnung von Fertiggerichten und industriell produzierten Lebensmitteln. Bei einer Pizza müsse dann bei sämtlichen Bestandteilen nachgewiesen werden, dass sie ohne Gentechnik hergestellt seien, sagte Koehler. Vergeben werden soll das Logo von einem neuen Verein der Lebensmittelindustrie - der aber erst noch gegründet werden muss.
| Logo "Ohne Gentechnik" |
In einer Broschüre formuliert das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Voraussetzungen für Lebensmittel, die mit dem Logo gekennzeichnet werden sollen. |
Trotz politischem Gegenwind setzt BASF nach wie vor auf die Gentechnik. So soll die im Jahr 2007 beschlossene Kooperation mit dem US-Konzern Monsanto in den nächsten Jahren Früchte tragen. Wie der Leverkusener Konzern auf einer Telefonkonferenz mit Investoren am 4. August mitteilte, soll mit gemeinsam entwickelten gentechnisch veränderten Pflanzensorten im Jahr 2020 ein Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. BASF traut der Grünen Gentechnik damit einiges zu. Denn noch ist die Agrarsparte der kleinste der sechs Geschäftsbereiche des Leverkusener Unternehmens und bringt wenig Geld ein, da sich sämtliche Projekte im Forschungsstadium oder in der oft schwierigen Zulassungsphase befinden, wie das seit Jahren andauernde Gerangel um die gentechnisch veränderte Kartoffel Amflora zeigt (mehr...). Denn vor allem in Europa stößt die Pflanzengentechnik auf Vorbehalte in der Öffentlichkeit. Einige Nationalstaaten - darunter inzwischen auch Deutschland - haben den Anbau des in Europa eigentlich zugelassenen Mais MON810 von Monsanto verboten, der gegen den Maiszünsler resistent ist (mehr...). Global gesehen geht BASF dennoch weiter von einem steilen Wachstum der Grünen Gentechnik aus. So werden nach Konzernangaben derzeit weltweit 2,5 Milliarden Euro mit gentechnisch veränderten Pflanzen umgesetzt. Im Jahr 2025 sollen es nach Konzernschätzungen bereits 35 Milliarden Euro sein.
Erfolg und Enttäuschung bei Nachahmerversionen von Biotech-Arzneien
Ratiopharm steht kurz vor der Zulassung seines zweiten EPO-Biosimilars zur Blutkörperbildung. Sandoz-Hexal dagegen musste eine klinische Studie zur Erweiterung des Anwendungsbereichs seines EPO-Biosmilars abbrechen.
Mit Biosimilars werden Kopien von biotechnologisch hergestellten Arzneien bezeichnet, deren Patentschutz inzwischen ausgelaufen ist. In Abgrenzung zu Nachahmer-Versionen von chemisch hergestellten Medikamenten soll der Begriff Biosimilar zum Ausdruck bringen, dass die Nachahmer-Versionen von biotechnologisch hergestellten Medikamenten ihren Originalen nur ähnlich, aber nicht komplett identisch sind. Dies ist schon aufgrund der Herstellung von Biotech-Medikamenten kaum möglich: Schließlich werden sie in lebenden Organismen oder Zellen hergestellt und bereits kleinste Abweichungen im Verfahren könnten zu schwer bemerkbaren, aber sicherheitsrelevanten Unterschieden führen. Nicht zuletzt aus diesem Grund müssen Generika-Unternehmen mehr Studien vorlegen, wenn sie ein Biosimilar zulassen wollen. Bei Ratiopharm knallen nun die Sektkorken, denn der humanmedizinische Ausschuss (CHMP) der europäischen Zulassungsbehörde EMEA hat dem Biosimilar Epoetin theta des Ulmer Generika-Spezialisten eine positive Empfehlung ausgesprochen. Diese mündet gewöhnlich innerhalb von Wochen in die offizielle Zulassung der EU-Kommission. Epoetin ist ein Hormon, dass die Bildung roter Blutkörperchen anregt. Es wird oft bei bei der Behandlung der Blutarmut von Dialysepatienten und nach einer aggressiven Chemotherapie eingesetzt. Das Ratioepo genannte Biosimilar soll ab dem vierten Quartal des laufenden Jahres verkauft werden.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
News: Biotech-Arzneien als Kostentreiber in der Kritik News: Erste Kopien von Biotech-Medikamenten drängen auf den Markt |
Weniger gute Nachrichten hat unterdessen der Generika-Konzern Sandoz-Hexal zu vermelden. Unerwartete Nebenwirkungen haben das Unternehmen dazu gezwungen, eine klinische Studie mit seinem Biosimilar Epoetin-alfa abzubrechen. Das blutbildende Hormon ist bereits in Deutschland zugelassen und wird unter den Markennamen Epoetin alfa Hexal (Hexal), Binocrit (Sandoz) sowie Abseamed (Medice Pütter) verkauft. Allerdings wird es bisher ausschließlich intravenös injiziert. Sandoz wollte deshalb in einer zusätzlichen klinischen Studie testen, ob sich das Biosimilar auch unter die Haut spritzen lässt. Anfang 2009 war es jedoch bei einem deutschen Probanden zu einer Fehlfunktion bei der Bildung roter Blutkörperchen gekommen. Ende Mai wurde ein zweiter Fall in Russland bekannt. Bei beiden wurden neutralisierende Antikörper gegen das blutbildende Hormon nachgewiesen. Nach Bekanntwerden des zweiten Falls wurde die klinische Studie auf Anraten einer Sicherheitskommission des Bundesinstitutes für Arzneimittel (BfArM) nun abgebrochen, wie die Behörde am 5. August mitteilte (mehr Infos: hier klicken).
Vom Tier zum Mensch: Informationsplattform über Zoonosen gestartet
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat im Internet eine Informations- und Forschungsplattform für Krankheiten eingerichtet, die vom Tier auf den Menschen überspringen.
Der Begriff Zoonose setzt sich aus den griechischen Worten für Lebewesen (zoon) und Krankheit (nosos) zusammen. Die sogenannte Schweinegrippe ist ein aktuelles Beispiel, aber auch SARS oder Salmonellen gehören zu den Zoonosen. Da die Erreger die Artengrenze überspringen, müssen auch die Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammenarbeiten, um den Entstehungsmechanismen der Krankheiten auf die Spur zu kommen.
Um den Austausch wissenschaftlicher Erkenntnisse zwischen Veterinär- und Humanmedizinern zu erleichtern und zu intensivieren, hat das BMBF nun die "Nationale Forschungsplattform für Zoonosen" eingerichtet. Die Plattform ist ein Informations- und Servicenetzwerk, um alle Forschungsinstitutionen zu bündeln, die aktiv im Bereich der zoonotischen Infektionskrankheiten in Deutschland arbeiten. Zudem dient die Plattform als Informationsstelle für die Öffentlichkeit.
| Zoonosen.net |
Auf der Webseite finden sich Terminhinweise auf Kongresse und Veranstaltungen, den Förderschwerpunkt Zoonotische Infektionskrankheiten des BMBF sowie Nachrichten und Interviews zu aktuellen Themen. |
"Die Erforschung von Zoonosen erfordert eine langfristige Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlichster Disziplinen", sagte Bundesforschungsministerin Annette Schavan bei der Präsentation der Seite. "Es geht darum, Wissen zu sammeln und es im Kampf gegen Zoonoseninfektionen einzusetzen. Dieses Wissen wollen wir transparent zusammenführen und der Öffentlichkeit zugänglich machen."
Betrieben wird die Zoonosenplattform von der Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e.V. (TMF) in Berlin, der Universität Münster und dem Friedrich-Löffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems. Ziele sind ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch, der Aufbau von Kooperationen und einer gemeinsamen Wissens- und Datenbank, um die Zoonosenforschung wirksamer und schneller zu machen.
Von der Haut- zur Stammzelle: Effizienz gesteigert
Mannheimer Forschern vom Universitätsklinikum ist es gelungen, die Erfolgsquote bei der Umwandlung von Haut- zu vielseitigen Stammzellen drastisch zu erhöhen.
Seit einigen Jahren können Wissenschaftler erwachsene Hautzellen zu vielseitigen Stammzellen zurückprogrammieren (mehr...). Diese sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) haben ebenso wie embryonale Stammzellen die Fähigkeit, sich in jegliches Gewebe entwickeln zu können. Aufgrund dieser Wandlungsfähigkeit gelten sie insbesondere in der Medizin als künftige Hoffnung, um Patienten aus eigenem Gewebe maßgeschneiderten Ersatz zu verschaffen und dabei nicht auf fremde Zellen zurückgreifen zu müssen. Jochen Utikal vom Universitätsklinikum Mannheim ist nun einem Mechanismus auf die Spur gekommen, mit dem iPS-Zellen mit hoher Erfolgsquote hergestellt werden können. Bislang hatte diese nämlich mehr mit Glücksspiel als mit Wissenschaft zu tun. Zwar wurden die Techniken in den letzten Monaten immer wieder verbessert (mehr...), allerdings lässt sich noch immer nur etwa eine von 10.000 Zellen in eine iPS-Zelle verwandeln. Utikal ist es nun gelungen, einen Mechanismus zu entschlüsseln, durch den sich die Rate der hergestellten iPS-Zellen wesentlich steigern lässt.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
News: Von der Hautzelle zur Stammzelle: Umprogrammierung mit gentechnischen Tricks |
Wie der Forscher im Fachmagazin Nature (Online-Veröffentlichung, 9. August 2009) berichtet, steht die Fähigkeit zur Zellteilung offenbar in direktem Zusammenhang mit der Verwandlung einer Zelle in einen pluripotenten Status. So konnten die Forscher zeigen, dass die Unterdrückung eines bestimmten Signalwegs (Arf-Trp53) - der mit der Zellteilung zusammenhängt - die Effizienz der Reprogrammierung drastisch steigert. Als Mitautor der Untersuchung ist Konrad Hochedlinger verzeichnet, der als einer der ersten Forscher in den USA mit iPS-Zellen arbeitet. Hochedlinger leitet eines der weltweit führenden Labors auf dem Gebiet der iPS-Zelltechnologie, das Harvard Stem Cell Institute des Massachusetts General Hospitals der Harvard University in Boston, USA. Während eines Forschungsaufenthalts von 2007 bis Anfang 2009 wirkte Utikal im Labor von Hochedlinger bei der Herstellung von iPS-Zellen aus Zellen der Haut mit. In Mannheim will Utikal nun die Möglichkeiten der therapeutischen Anwendung von iPS-Zellen erforschen. Da der jetzt identifizierte Mechanismus auch bei der Entstehung von Tumoren eine wesentliche Rolle spielen kann, wird auch die Tumorforschung Gegenstand seiner wissenschaftlichen Arbeit sein.
Epigenetik: Krebsrisiko durch stillgelegte Gene früh anzeigen
Anhand von epigenetischen Veränderungen des Erbguts haben Forscher das Risiko von Blutkrebs bei Mäusen erkannt, bevor erste sichtbare Symptome der Krankheit aufgetreten sind.
Im Erbgut von Krebszellen sind wichtige Wachstumsbremsen oft durch chemische Markierungen der DNA stillgelegt. Wie sich solche epigenetischen Marker als Diagnostik-Möglichkeit nutzen lässt, das haben Wissenschaftler vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg nun gemeinsam mit Kollegen von der amerikanischen Ohio State University untersucht. Sie entdeckten, dass bei Mäusen die krebstypischen Erbgut-Markierungen lange vor den ersten Symptomen einer Blutkrebs-Erkrankung auftreten. Ein Test auf die Genmarkierung könnte daher eine entstehende Krebserkrankung frühzeitig aufspüren, berichten die Forscher im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Science (PNAS, Online-Vorabveröffentlichung, 28. Juli 2009).
Bei vielen Krebserkrankungen sind Teile des Erbguts der Tumorzellen durch chemische Markierungen, so genannte Methylierungen, stillgelegt. Die Methylierung zählt zu den epigenetischen Veränderungen, die zwar nicht die Reihenfolge der DNA-Bausteine verändert, aber die Aktivität der Gene steuern können. Besonders häufig sind ausgerechnet solche Gene betroffen, die als wichtige Bremsen des krankhaften Zellwachstums wirken. Krebsforscher wissen nicht, warum sich gesunde und Krebszellen im Methylierungsmuster unterscheiden und warum gerade die Krebsbremsen so häufig ausgeschaltet werden.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
Notiz: Strategische Allianz zwischen Bayer und DKFZ biotechnologie.tv: Epigenetik - erklärt in der Kreidezeit Im Profil: Robert Schneider - Fasziniert von der Architektur des Erbguts |
DKFZ-Forscher Christoph Plass hat sich dieses Problems nun angenommen und wollte herausfinden, wann im Verlaufe der Krebsentstehung erste epigenetische Markierungen auftreten. Als Untersuchungsmodell für ihre gerade veröffentlichte Studie wählten die Wissenschaftler Mäuse, die an chronisch-lymphatischer Leukämie erkranken. Wie sie im Fachblatt PNAS berichten, treten erste krebstypische Methylierungsmuster bereits bei drei Monate alten Mäusen auf, also weit vor den ersten Symptomen der Erkrankung, die üblicherweise erst bei dreizehn Monate alten Tieren beobachtet werden. Darüber hinaus konnten die Forscher zeigen, dass die Methylierungsmuster im Mäuse-Erbgut weitgehend mit denen übereinstimmen, die auch bei Leukämie-kranken Menschen gefunden werden. Das nehmen die Forscher als Bestätigung dafür, dass sich die Leukämie-Mäuse gut als Untersuchungsmodell eignen. Langfristig, so hofft Plass, könnten die Methylierungsmuster einmal Hinweise auf ein Krebsrisiko anzeigen und als Angriffspunkt für präventive Therapien dienen - beispielsweise mit Medikamenten, die eine Anheftung der Methylgruppen verhindern und damit die Krebsentstehung verzögern. Im Gegensatz zu Genmutationen, die die Abfolge der Erbgutbausteine endgültig verändern, sind alle epigenetischen Markierungen nämlich reversibel und daher potenzielle Zielstrukturen für entsprechende Arzneien. Erste klinische Studien dazu laufen bereits.
Drogenfeste Fische liefern genetisches Set für Anti-Suchtpotenzial
Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums München haben einen Fisch gefunden, der von Drogen nicht abhängig werden kann und erste interessante Genregionen entdeckt, die dafür verantwortlich sind.
Bislang ist das Wissen darum, wie Abhängigkeiten von Drogen und die damit einhergehenden Gehirnveränderungen entstehen sehr lückenhaft. Katharine Webb und Laure Bally-Cuif, Forscherinnen am Institut für Entwicklungsgenetik des Helmholtz-Zentrums München, wollten das ändern und wählten für ihre Arbeiten einen umfassenderen Ansatz, der Zebrabärblinge als Untersuchungsmodell beinhaltet.
Wie die Wissenschaftlerinnen im Fachmagazin Genome Biology (Vol. 10, 2009, Ausg. 7) berichten, mischten sie zunächst eine Mutationen auslösende Substanz in Becken mit männlichen Zebrabärblingen (Danio rerio). Bei deren Nachwuchs versuchten sie dann, eine Sucht nach Amphetamin auszulösen. Bei den allermeisten der knapp 400 getesteten Tiere gelang dies auch – sie konnten durch die starke Droge in einen Teil ihres Aquariums gelockt werden, den sie ursprünglich gemieden hatten. Lediglich vier, ansonsten völlig normale Tiere erwiesen sich als unempfänglich, eines davon vererbte diese Eigenheit an seine Nachkommen.
| Der Zebrafisch in der Biotechnologie |
biotechnologie.tv: Spektakuläre Aufnahmen eines Zebrafisch-Embryos |
Das war schließlich der Kandidat für die weitere Untersuchung der genetischen Ausstattung dieses Tieres. Anhand der Analyse von gut 43.000 Genen konnten die Forscher insgesamt 139 Genen identifzieren, die bei dieser “nad”-Mutante (”no addiction”) und normalen Artgenossen nach einem Kontakt mit Amphetamin unterschiedlich stark aktiviert oder deaktiviert wurden. Ein Teil dieser Gene spielt eine Rolle im “Belohnungssystem” des Gehirns, das am Empfinden von Befriedigung und an der Entstehung von Sucht beteiligt ist. Überraschenderweise, so die Foirscher, sind auch solche Gene vertreten, die während der Gehirnentwicklung die Aktivität anderer Gene koordinieren. Bei normalen, ausgewachsenen Zebrabärblingen trat dieses genetische Netzwerk erneut in Aktion, sobald die Fische Kontakt mit ihrer Droge hatten. Nun müssen weitere Untersuchungen klären, ob sich tatsächlich einzelne Gene identifizieren lassen, mit denen die Entwicklung einer Sucht gezielt verhindert werden kann.