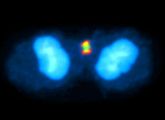Wochenrückblick KW 42
Rückblick auf Kalenderwoche 42
Für den Zeitraum vom 17. bis 24. Oktober 2011 hat biotechnologie.de für Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Biotech-Branche zusammengestellt.
Impfstoffkandidat gegen Malaria auf Erfolgskurs
Bei der Erprobung eines Impfstoffkandidaten gegen die Tropenkrankheit Malaria können Mediziner vielversprechende Erfolge verbuchen.
Der experimentelle Impfstoff des britischen Pharmakonzerns GlaxoSmithKline hat sich in einer klinischen Großstudie der Phase III als wirksam zum Schutz vor der Krankheit erwiesen. Erste Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine (2011, Online-Vorabveröffentlichung) veröffentlicht.
| Mehr auf biotechnologie.de |
Die Autoren dieser Studie sind alle Mitglieder eines internationalen Forscherkonsortiums, darunter auch eine Reihe von Medizinern vom Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen. Im Rahmen der Studie konnte das Präparat mit dem Namen "RTS,S" bei afrikanischen Kindern im Alter von fünf bis 17 Monaten das Risiko halbieren, an klinischer oder schwerer Malaria zu erkranken. Die Substanz könnte damit der erste Impfstoff gegen die tödliche Krankheit werden, an der weltweit jedes Jahr immer noch rund 800.000 Menschen sterben.
Die meisten Toten fordert die von der Anopheles-Stechmücke übertragene Krankheit bei Kindern unter fünf Jahren in den armen Ländern Afrikas südlich der Sahara. GSK entwickelt den Impfstoff zusammen mit der gemeinnützigen Path Malaria Impfstoff Initiative (MVI), die von der Bill & Melinda Gates Stiftung finanziert wird. Bei den vorgestellten Daten handelt es sich um erste Testergebnisse aus einer noch laufenden Studie, an der elf Studienzentren in sieben afrikanischen Ländern beteiligt sind. Forscher analysierten jetzt Daten von 6000 Kindern, die mit der Substanz geimpft und danach zwölf Monate lang beobachtet wurden. Dabei zeigte sich, dass sich mit drei Dosen der Impfsubstanz RTS,S das Risiko der Kinder, an klinischer oder schwerer Malaria zu erkranken, um 56 beziehungsweise 47 Prozent verringert. Bei etwa 75 Prozent der Teilnehmer wurden auch mit Insektengift behandelte Moskitonetze genutzt. Ergebnisse bei Säuglingen im Alter von sechs bis zwölf Wochen werden zum Jahresende 2012 erwartet. GlaxoSmithKline zufolge könnte der Impfstoff - falls die weitere Entwicklung gut läuft - 2015 auf den Markt kommen. Malaria wird durch den Parasiten Plasmodium falciparum verursacht, der sich im Speichel der Anopheles-Mücke befindet. RTS,S soll das Immunsystem ankurbeln, damit es sich gegen den Endringling besser verteidigen kann, wenn er erstmals nach dem Stich in den Blutkreislauf eindringt. RTS,S soll dann den Parasiten über eine Immunreaktion daran hindern, in der Leber zu reifen und sich zu vermehren.
© biotechnologie.de/pg
Strategieprozess zu Innovationen in der Medizintechnik gestartet
In einem nationalen Strategieprozess will die Bundesregierung Handlungsbedarf in der Medizintechnik ausloten und eine ressortübergreifende Innovationspolitik dreier Bundesministerien auf den Weg bringen.
Am 20. Oktober haben dazu die Staatsekretäre des Bundesforschungsministeriums, des Bundesgesundheitsministeriums und des Bundeswirtschaftsministeriums, Dr. Georg Schütte, Thomas Ilka und Ernst Burgbacher, ein hochrangig besetztes Expertengremium aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Gesundheit einberufen. Die Fachleute beraten in den kommenden Monaten, um gemeinsam eine kohärente Innovationspolitik in der Medizintechnik zu entwickeln. Ein Ergebnisbericht soll Ende 2012 vorliegen. Es sollen Wege gefunden werden, wie der Innovationsprozesse in der Medizintechnik weiter beschleunigt und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Medizintechnikindustrie gestärkt werden können. Ziel ist es vor allem, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern und Entwicklungen schneller aus dem Labor an das Patientenbett zu bringen.
| Mehr auf biotechnologie.de |
Wirtschaft: Berlin: Impulse für die Medizintechnik der Zukunft gefragt |
BMBF-Staatssekretär Georg Schütte sagte: "Der nationale Strategieprozess wurde ganz im Sinne der Hightech-Strategie angestoßen. Für eine zusammenhängende Innovationspolitik müssen wir die Förderung gemeinsam mit einer Verbesserung der Rahmenbedingungen in den Blick nehmen. Deshalb diskutieren wir Themen wie Fachkräftemangel, neue Kooperationsmodelle Anforderungen an klinische Studien und alternative Finanzierungskonzepte." Der BMG-Staatsekretär Thomas Ilka betonte, medizintechnische Innovationen müssten schnellstmöglich allen Versicherten zur Verfügung stehen. „Das kann nur gelingen, wenn wir die für die Versorgung relevanten Innovationen identifizieren und zügig in der Regelversorgung etablieren“, sagte er. Mit der Erprobungsregelung für innovative Untersuchungs- und Behandlungsmethoden habe das Gesundheitsministerium bereits Maßstäbe gesetzt“
Ernst Burgbacher vom Bundeswirtschaftsministerium unterstrich: "Health - Made in Germany hat einen weltweit guten Ruf. Und diesen guten Ruf wollen wir nutzen, um mehr mittelständischen Unternehmen den Zugang zu den weltweiten Märkten zu öffnen.
© biotechnologie.de/pg
Forscher konstruieren Vorhersagemodell für Alzheimer
Forscher des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin (MDC) in Berlin haben zusammen mit Kollegen der Universität Rostock erstmals ein mathematisches Modell entwickelt, mit dem sich der Beitrag genetischer Risikofaktoren bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit bestimmen lässt. „Dieses Vorhersagemodell lässt sich auch auf andere Risikofaktoren anwenden, welche von zentraler Bedeutung für die Entstehung der Krankheit sind", sagt Thomas Willnow, einer der beteiligten Wissenschaftler. "Doch erst, wenn es auch eine Therapie gegen Alzheimer gibt, ist es sinnvoll, mit solchen Vorhersagemodellen Risikopatienten für eine frühzeitige Behandlung zu identifizieren.“
| Mehr auf biotechnologie.de |
Menschen: André Fischer - Hilft dem Gedächtnis auf die Sprünge News: Deutsche Forscher entdecken neue Ansätze für Alzheimer-Therapien Wochenrückblick: Evotec entwickelt Alzheimer-Arznei mit Roche |
Das Modell, das die Forscher im EMBO Journal (2011, Online-Veröffentlichung) fußt auf dem Transportmolekül SORLA (sorting protein-related receptor). Es wird von Nervenzellen produziert und beeinflusst die Bildung gefährlicher Eiweißablagerungen im Gehirn, die charakteristisch für die Alzheimer-Krankheit sind. Diese Plaques im Gehirn von Alzheimer-Patienten bestehen aus den sogenannten Amyloid-beta Peptiden, die aus dem Amyloid-Vorläufer-Protein (engl. Abk.: APP) entstanden sind.Vor einigen Jahren war Willnow aufgefallen, dass SORLA an das Vorläuferprotein APP bindet. Damit verhindert SORLA, dass sich die gefährlichen Plaques bilden. Nach ersten Forschungen an Mäusen untersuchten Willnow und seine Kollegen in Berlin die Gehirne von Menschen, die an Alzheimer gestorben waren, und von Menschen, die nicht an Alzheimer erkrankten. Sie entdeckten, dass Alzheimer-Kranke sehr viel häufiger mit einer Variante des SORLA-Gens ausgestattet waren. Bei ihnen bildeten die Nervenzellen deutlich weniger SORLA als normal.
Das deutet darauf hin, dass bei manchen Menschen das Gehirn aus genetischen Gründen weniger SORLA produziert und dass die damit verbundene ungebremste Produktion von Amyloid-beta Peptid in diesen Patienten ein Risikofaktor zur Entstehung von Alzheimer sein könnte. „Schon 20 Prozent weniger SORLA wirken sich negativ auf die Funktion von Nervenzellen aus und erhöhen des Krankheitsrisiko“, erläutert Willnow.„Vorausgesetzt es gibt eine wirksame Therapie, könnten wir mit unserer Modellrechnung abschätzen, ab welchem Produktionsgrad von SORLA ein Risiko besteht, an Alzheimer zu erkranken. Dann könnte mit einer wirksamen Behandlung frühzeitig gegengesteuert werden“, so der Forscher.
© biotechnologie.de/cm
Fraunhofer-Gruppe Translationale Medizin in Frankfurt
Mit einem vom Land Hessen geförderten Forschungsschwerpunkt "Anwendungsorientierte Arzneimittelforschung" und einer Fraunhofer-Projektgruppe Translationale Medizin und Pharmakologie setzt die Goethe-Universität Frankfurt neue Akzente in der klinischen Forschung.
Ziel des neuen Schwerpunktes ist es, in Kooperation mit der Industrie vorhersagende präklinische und klinische Modelle zu entwickeln, um möglichst früh Aussagen über die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneistoffen treffen zu können. So sollen die Erfolgsraten der klinischen Entwicklung drastisch gesteigert werden. „Die Umsetzung relevanter Forschungsergebnisse in die klinische Anwendung funktioniert bisher in Deutschland nicht zufriedenstellend“, sagte Gerd Geisslinger, Leiter der neuen Fraunhofer-Projektgruppe. Im Gegensatz zu amerikanischen Universitäten hätten deutsche Hochschulen in den vergangenen zehn Jahren de facto keine Rolle bei der Entdeckung innovativer Arzneimittel gespielt.
| Mehr auf biotechnologie.de |
Wochenrückblick: Neue Forschungsnetzwerke zur Wirkstoffforschung gestartet Wochenrückblick: 16 Millionen Euro für Zell- und Gentherapieforschungszentrum in Frankfurt Wochenrückblick: Millionen für die Biotechnologie in Hessen und Hamburg |
Mit dem im Rahmen der hessischen Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz LOEWE geförderten Zentrum soll die Übertragung der Forschungsergebnisse nun beschleunigt werden. Der LOEWE-Schwerpunkt soll dabei das an der Universität vorhandene Fachwissen auf den Gebieten Wirkstoffforschung, präklinische und klinische Modellentwicklung und klinische Forschung zusammenführen und weiterentwickeln. Die Fraunhofer-Projektgruppe soll die gemeinsamen Bemühungen von Wirtschaft und Wissenschaft zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Arzneimittelforschung in Deutschland koordinieren, um die Entwicklungskosten von Medikamenten zu reduzieren. Es ist geplant, dass der LOEWE-Schwerpunkt nach drei Jahren zunächst zu einem LOEWE-Zentrum ausgebaut wird und später in ein eigenständiges Fraunhofer-Institut umgewandelt wird.
© biotechnologie.de/bk
Wie sich Stammzellen abnabeln
Max-Planck-Forscher in Dresden haben entdeckt, dass Stammzellen bei ihrer Teilung eine bestimmte Zellstruktur schneller entsorgen als Krebszellen.
Die Struktur namens Midbody stellt zwischen den entstehenden Tochterzellen das letzte Verbindungsstück dar. Wie an einem seidenen Faden hängen die Zellen der neuen Generation noch aneinander. Dresdner Max-Planck-Forscher um Wieland Huttner haben nun untersucht, wie Zellen mit der Übergangsstruktur umgehen.
Das Abstoßen des Midbody hängt offenbar mit der Fähigkeit von Zellen zusammen, sich auszudifferenzen: Stammzellen werfen im Gegensatz zu Krebszellen öfter ihren Midbody einfach ab. Bisher ging man immer davon aus, dass der Midbody an eine der beiden Tochterzellen mitgegeben und dort langsam abgebaut wird. Das Team um Wieland Huttner vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik berichtet im Fachjournal Nature Communications (2011, Online-Veröffentlichung). Die Max-Planck-Forscher haben bereits vor Jahren beobachtet, dass den Midbody auch ein ganz anderes Schicksal ereilen kann: Studien am sich entwickelnden Gehirn zeigten, dass bestimmte Zellen das filigrane Verbindungsstück einfach komplett an beiden Seiten abschneiden und in die Zellperipherie abstoßen. In Zellkultur-Experimenten sollte das Phänomen der kompletten Midbody-Abnabelung genauer untersucht werden.
| Mehr auf biotechnologie.de |
News: Pluripotente Stammzellen auf dem Prüfstand News: Henrietta Lacks: tot und doch unsterblich Förderbeispiel: Alternde Zellen mit Laser und 3D-Mikroskop untersuchen |
In den zunächst untersuchten Zellkulturen war der Vorgang zur Verwunderung der Forscher nicht zu beobachten. Erst als sie ratlos auf neurale Stammzellen umstiegen, wurden sie fündig. Das Umschwenken lieferte sogleich die Erkenntnis und Erklärung: Stammzellen weisen viel häufiger die Fähigkeit auf, den seidenen Faden nach der Zellteilung komplett abzuwerfen; Krebszellen oder für die Zellkultur unsterblich gemachte Zellen hingegen deutlich weniger. Das konnten die Forscher nun genau messen. Umgekehrt bedeutet das auch: Die Fähigkeit zum Midbody-Abstoßen scheint für eine Zelle mit der Fähigkeit einherzugehen, sich zu differenzen. Möglicherweise liefere diese Erkenntnis, so die Forscher, einen hebel für eine künfitge Krebstherapie. Hierin könnte man eines Tages Krebszellen so manipulieren, dass sie wie Stammzellen ihren Midbody abgeben und ausdifferenzieren – und so ihr unreguliertes Wachstum einstellen.
© biotechnologie.de/pg
Boehringer und Universität Ulm gründen Biozentrum
Das neue Boehringer Ingelheim Ulm University Biocenter (BIU) ist ein in Deutschland einmaliges Konstrukt: Ausgestattet mit einem Budget von insgesamt 4,5 Millionen Euro bis 2014 soll das Zentrum Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung näher zusammenbringen.
Die Kooperation „stärkt die Weiterentwicklung und Vertiefung der äußerst erfolgreichen wissenschaftlichen Zusammenarbeit in der Pharmazeutischen Biotechnologie innerhalb der BioRegion Ulm und eröffnet neue Möglichkeiten für die in der Exzellenzinitiative geförderte Graduiertenschule für Molekulare Medizin“, sagte Karl Joachim Ebeling, Präsident der Universität Ulm. Die Partnerschaft ist strukturell wie ein Sonderforschungsbereich ausgelegt – und mit einem ähnlichen Zeithorizont, ungefähr zehn Jahre, ausgestattet. Boehringer Ingelheim fördert den Forschungsverbund mit insgesamt 2,25 Millionen Euro. Die Universität Ulm wird 750.000 Euro einbringen. Das Land unterstützt das BIU bis zum Jahr 2014 mit insgesamt 1,5 Millionen Euro.
| Mehr auf biotechnologie.de |
Wochenrückblick: Boehringer erhält EU-Zulassung für Schlaganfall-Pille |
„Ich bin überzeugt, dass wir im Schulterschluss mit der eher grundlagen-orientierten universitären Forschung der Universität Ulm gemeinsam mehr fruchtbaren Boden bestellen und tiefere Erkenntnisse gewinnen können, als unabhängig voneinander“, sagte Andreas Barner, Sprecher der Unternehmensleitung von Boehringer Ingelheim. Der Pharmakonzern hat mit akademischen Kooperationsprojekten in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht. Das Institut für Molekulare Biologie (IMB) an der Universität Mainz und das Institut für Molekulare Pahtologie (IMP) in Wien gehen wesentlich auf Initiativen des Ingelheimer Unternehmens zurück. Das BIU widmet sich drei Schwerpunkten: neurodegenerative und kardiometabolische Krankheitsbilder sowie Lungenerkrankungen. Diese Gesundheitsbereiche sind von großer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb zeigte sich Thomas Wirth, Dekan der Ulmer Medizinischen Fakultät erfreut: „Es ist Auszeichnung und Ansporn zugleich und wird die patientenorientierte Grundlagenforschung sicher entscheidend beflügeln."
© biotechnologie.de/bk