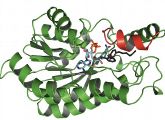Wochenrückblick KW 25
Rückblick auf Kalenderwoche 25
Für den Zeitraum vom 21. bis 28. Juni 2010 hat biotechnologie.de für Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Biotech-Branche zusammengestellt.
Bundesverfassungsgericht überprüft Gentechnikgesetz
Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am 23. Juni die mündliche Verhandlung zum Gentechnikgesetz begonnen.
Die Karlsruher Richter verhandeln über eine Normenkontrollklage der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, die mehrere strengen Auflagen des Gesetzes zum Einsatz der Gentechnik in der Landwirtschaft für verfassungswidrig hält. Die Kläger stoßen sich besonders an dem Grundsatz, dass Landwirte dafür haften sollen, wenn etwa gentechnisch veränderter (gv) Mais in Felder mit herkömmlich gezüchteten Nutzpflanzen gelangt. Nach Auffassung des Bevollmächtigten der Landesregierung von Sachsen-Anhalt, Marcel Kaufmann, schränken die Regelungen Forschung, Entwicklung und Anbau der Gentechnik stark ein und sind deshalb verfassungswidrig.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
Wochenrückblick: Biotech-Branchenverband attackiert Gentechnikgesetz Wochenrückblick: Anbau von MON810-Mais bleibt auch 2010 verboten Dossier: Die Zulassung von gentechnisch veränderten Pflanzen |
Ferner stelle das Standortregister, in dem alle Felder mit gentechnischem Anbau genau aufgelistet sind, eine erhebliche Belastung für die Besitzer dar. Denn auch Feldzerstörer würden diese frei zugänglichen Daten nutzen. "So wird jeder Freisetzungsversuch zu einem erheblichen finanziellen Risiko", sagte Kaufmann. Mit dem mehrfach novellierten Gentechnik-Gesetz wird in Deutschland seit 1990 der Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen geregelt - also deren Herstellung, Nutzung und Freisetzung.Die verschärften Regelungen zum Nebeneinander von herkömmlichen Nutzpflanzen und gv-Organismen -insbesondere zur Haftung und zum öffentlichen Standortregister- waren Ende 2004 unter der rot-grünen Bundesregierung aufgenommen worden. Umweltverbände bewerteten die Klage der sachsen-anhaltinischen Regierung als „Frontalangriff auf gentechnikfreie Landwirtschaft und Lebensmittel“. Sollte sich Sachsen-Anhalt durchsetzen, werde die Unterscheidung von gentechnikfreien und genmanipulierten Lebensmitteln nicht mehr möglich sein. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Normenkontrollklage wird in einigen Monaten erwartet.
Deutsche Forscher streiten um Hodenstammzellen
Der Münsteraner Stammzellforscher Hans Schöler hat erhebliche Zweifel an der Existenz von pluripotenten Stammzellen in Hoden angemeldet und damit einen hitzigen Streit mit dem Tübinger Forscher Thomas Skutella angefacht.
In dem Wissenschaftlerstreit geht es um eine Veröffentlichung aus dem Jahre 2008, die unter Stammzellforschern für viel Aufmerksamkeit sorgte: Darin beschreibt Thomas Skutella vom Zentrum für Regenerationsbiologie und Regenerative Medizin (ZRM) an der Tübinger Universität, wie sein Forscherteam aus dem Hodengewebe von Patienten Alleskönner-Zellen gezüchtet habe, also pluripotente Stammzellen, die sich in alle 200 Gewebe des Körpers entwickeln können (mehr...). Damit schienen die Tübinger eine alternative Methode zur Stammzellgewinnung gefunden zu haben, ohne dafür Embryos töten zu müssen.
Doch einige deutsche Forscher bezweifeln nun offensiv, dass die Tübinger Zellen aus dem Hoden tatsächlich pluripotent sind. Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin (MPI) in Münster hat zusammen mit Martin Zenke vom Institut für Biomedizinische Technologien an der RWTH Aachen eine Kritik in Nature (24. Juni 2010. Bd. 465. S. E1) veröffentlicht.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
News: Vielseitige Stammzellen im menschlichen Hoden entdeckt Förderbeispiel: Ethisch unbedenklicher Zellersatz aus den Keimdrüsen |
Darin ziehen die Forscher aus eigenen Genaktivitäts-Analysen bei Hodenzellen den Schluss, das es sich bei den Tübinger Zellen offenbar nicht wie seinerzeit präsentiert um Stammzellen sondern vielmehr um simple Bindegewebszellen (Fibroblasten) handele. Desweiteren wirft Schöler Skutella vor, sich nicht an gängige Forschungsstandards zu halten. Denn keine andere Forschergruppe habe bisher die vermeintlichen Alleskönnerzellen aus Tübingen selbst in Augenschein nehmen können, wie es sich für derart hochrangige Veröffentlichungen gehöre. Skutella hatte bereits 2009 zu diesem Missstand eine Ergänzung seiner Arbeit veröffentlicht. Darin begründet er, die Einverständniserklärungen der Patienten erlaubten nicht, die Zellen weiterzugeben. Dem Tagesspiegel sagte er jedoch ,in einigen Monaten Zellen an Forscherkollegen liefern zu wollen. In seiner Antwort auf die aktuelle Kritik in Nature schreibt der Tübinger Anatomieprofessor (24. Juni 2010, Bd. 465, S. E3), die Genaktivitätsanalysen der Münsteraner eigneten sich nicht für einen aussagekräftigen Vergleich und gäben daher ein verzerrtes Ergebnis wider. Skutella betonte zudem, bevorstehende Veröffentlichungen über Experimente an hochwertigerem Zellmaterial sollten die vorherrschende Skepsis gegenüber den Hodenstammzellen ausräumen.
MorphoSys füllt Pipeline mit Einlizensierung
Die MorphoSys AG hat zum ersten Mal einen Medikamentenkandidaten eines anderen Biotech-Unternehmens eingekauft.
Wie MorphoSys am 27. Juni meldete, erhalten die Martinsrieder durch die Vereinbarung eine weltweit exklusive Lizenz auf den Krebsantikörper XmAb5574, der vom US-Unternehmen Xencor zur Behandlung von B-Zell-Tumoren entwickelt wurde. Die beiden Unternehmen werden die demnächst startende klinische Studie der Phase I zum Einsatz bei lymphathischer Leukämie gemeinsam durchführen, danach ist Morphosys alleine zuständig. Xencor erhält eine Vorauszahlung in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro. Weiterhin stehen dem US-Unternehmen entwicklungs- und vermarktungsbezogene Meilensteinzahlungen sowie mehrstufige Tantiemen auf Produktverkäufe zu.
XmAb5574, der von MorphoSys in MOR208 umgetauft wurde, ist ein humanisierter, monoklonaler Antikörper , der gegen das Protein CD 19 auf der Oberfläche bestimmter Immunzellen (B-Zellen) gerichtet ist. Zur Behandlung maligner Erkrankungen der B-Zellen wurde das Molekül von Xencor auf eine gesteigerte Immunantwort hin getrimmt.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
Menschen: Simon Moroney-Mit Morphosys nach Antikörpern fischen |
CD19 wird in der B-Zell-Entwicklung früher und umfassender exprimiert als CD20, das Zielmolekül des bereits auf dem Markt befindlichen Krebsmedikaments Rituxan von Roche. Rituxan wird auch für die Therapie von Rheumatoider Arthritis eingesetzt. Auch Morphosys hofft deshalb auf eventuell breitere Einsatzmöglichkeiten.
MorphoSys-Vorstandsvorsitzender Simon Moroney sieht die erste Einlizenzierung eines fremden Moleküls als wichtigen Schritt zur Ergänzung der hauseigenen Pipeline, die bisher aus Antikörperkandidaten besteht, die mit der eigenen HUCAL-Technologie entstanden sind. "Der stabile Mittelzufluss aus unserem Geschäftsbereich Partnered Discovery ermöglicht es uns, ein attraktives eigenes Entwicklungsprogramm zu unterstützen, für das MOR208 eine wichtige Ergänzung ist", so Moroney. MorphoSys beendete das Geschäftsjahr 2009 mit 81 Millionen Euro Umsatz, der Gewinn lag bei 9 Millionen Euro.
Zwei neue BMBF-Förderinitiativen zu molekularen Therapien und Diagnostik
Mit zwei neuen Förderinitiativen will das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) die Entwicklung neuer molekularer Therapien und Diagnose-Verfahren vorantreiben.
Wie das BMBF am 22. Juni bekannt gab, sollen in der Initiative „Innovative Therapieverfahren auf molekularer und zellulärer Basis“ vielversprechende Forschungs- und Entwicklungsansätze im Gebiet der molekularen Medizin gefördert werden. Im Fokus stehen Vorhaben von Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und kleinen und mittleren Unternehmen, die innovative Behandlungsmethoden entwickeln und validieren. Dazu zählen etwa Gentherapien, regenerative Zelltherapien, Immuntherapien oder etwa Verfahren, die die Aktivität bestimmter Gene modulieren. Forschergruppen aus Akademie und Industrie sollen möglichst in Verbünden zusammenarbeiten. Vorhabenbeschreibungen können bis zum 11. Oktober 2010 beim Projektträger im DLR eingereicht werden (mehr Informationen: hier klicken).
Im Fokus der Förderinitiative zur „Molekularen Diagnostik“ steht wiederum die Weiterentwicklung und ausgiebige Prüfung aussagekräftiger Biomarker. Biomarker sind bestimmte Genbausteine, Substanzen oder Eiweiße im Körper, mit deren Hilfe Forscher Aussagen über die Beginn oder den Verlauf einer Erkrankung machen können. Einer der größten Engpässe in der Forschung ist die Validierung, also die klinische Überprüfung der Biomarker auf ihre Sicherheit und Aussagekraft. Gerade die klinische Entwicklung und die Validierung soll in der neuen Förderinitiative besonders gefördert werden.
Unterstützt werden sollen auch hier Forschungsprojekte an Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und in Biotechnologie-Unternehmen. Ziel sollte es sein, Biomarker zu entwickeln, die eine besonders frühe Diagnose von Erkrankungen ermöglicht. Für Projekte mit klinischem Bezug soll es darum gehen, Biomarker zu finden, die unerwünschte Medikamenten-Nebenwirkungen vorrausssagen helfen, eine maßgeschneiderte Arznei-Therapie ermöglichen oder dabei helfen, den Therapieverlauf zu bewerten. Vorhabenskizzen können bis zum 7. Oktober 2010 beim Projektträger im DLR (mehr Informationen: hier klicken)
Hochwirksamer Hemmstoff hält Tuberkulose in Schach
Würzburger Strukturbiologen haben einen neuen vielversprechenden Wirkstoff entwickelt, der die Vermehrung von Tuberkulose-Erregern stoppen kann.
Ein Team von Wissenschaftlern um Caroline Kisker vom Rudolf-Virchow-Zentrum in Würzburg berichtet in der Fachzeitschrift Journal of Biological Chemistry (2010, Bd. 285, S. 14330) von der Substanz, die es dem Bakterium unmöglich macht, seine Zellwand zu bilden und sich zu vermehren. Zum Leidwesen der Mediziner entwickeln die Erreger zunehmend Resistenzen gegen gängige Antibiotika. Gegen diese "Superbugs" wurde seit Jahren kein neues Tuberkulose-Medikament mehr entwickelt. Eine Achillesferse der Tuberkulose-Keime ist die Biosynthese der Zellwand. Bei Mycobacterium tuberculosis besteht die Zellwand zum Großteil aus Mykolsäuren, sehr langkettigen Fettsäuren, die den Bakterien Schutz bieten und ihnen ermöglichen, in Fresszellen des Immunsystems zu überdauern. Das Enzym namens InhA ist an der Herstellung dieser Fettsäureketten maßgeblich beteiligt. Die Fettsäuren werden im Enzym in einer so genannten Substrattasche hergestellt.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
News: Wie ein neues Antibiotikum gegen multiresistente Keime wirkt |
Das Team um Caroline Kisker hat nun einen Wirkstoff geschaffen, der diese Substrattasche blockiert. Zudem bleibt er möglichst lange darin haften und verhindert so wirksam die Bildung der Zellwand. Der neue Wirkstoff namens PT70 ist länger als der bisher verwendete Wirkstoff Triclosan und reicht noch weiter in die Substrattasche hinein. Eine optimierte Zusammensetzung bewirkt zusätzlich, dass PT70 noch besser an das Enzym InhA andockt. Zudem schafft es der neue Wirkstoff, ähnlich wie die Fettsäure die Substrattasche zu schließen – ein entscheidendes Kriterium für die Wirksamkeit. Alle Faktoren zusammen bewirken, dass PT70 rund 24 Minuten an das Enzym gebunden bleibt. Das ist etwa 14.000 Mal länger als bei bisherigen Substanzen wie Triclosan und sollte deshalb als Medikament wesentlich wirksamer sein als die im Vergleich nur kurz gebundenen Substanzen.
Neue Theorie zum Tod von Pharao Tutanchamun
Hamburger Tropenmediziner haben Zweifel an der von einer ägyptischen Wissenschaftlergruppe ermittelten mutmaßlichen Todesursache des legendären Pharaos Tutanchamun angemeldet.
Dieser sei möglicherweise doch nicht an Malaria in Kombination mit einem seltenen Knochendefekt, sondern an der erblich bedingten Sichelzellanämie gestorben, argumentieren die Mediziner Christian Timmann und Christian Meyer vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI). Tutanchamun, dessen goldene Totenmaske weltberühmt ist, lebte vor rund 3300 Jahren. Der Kindpharao bestieg den Thron mit nur neun Jahren und starb bereits zehn Jahre später. Ein Wissenschaftlerteam hatte im Auftrag der ägyptischen Altertumsverwaltung genetische Profile Tutanchamuns und seiner Verwandten erstellt. Wie die Forscher um den Ägyptologen Zahi Hawass diesen Februar im Fachjournal JAMA (17. Februar 2010. Bd.303, S. 638) berichteten, fanden sie die Bestätigung dafür, dass der Herrscher aus einer Inzestbeziehung seines Vaters, dem berühmten Pharao Echnaton, mit einer seiner Schwestern stammte. Da die Experten bei ihren Analysen Erbgutreste des Malaria-Parasiten in der Mumie nachgewiesen hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass eine schwere Malaria zusammen mit der Schwächung durch die Köhlersche Knochenkrankheit für den frühen Tod des Pharaos verantwortlich war.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
In dem nun ebenfalls in JAMA (23. Juni 2010, Bd. 303, S.2473) veröffentlichten Kommentar äußerten die Hamburger Forscher nun aber die Vermutung, Tutanchamun sei womöglich eher an der Sichelzellenkrankheit gestorben. Bei dieser nehmen die roten Blutkörperchen eine Sichelform an, verschließen Blutgefäße und schädigen Organe und Knochen. Es handle sich um eine Erbkrankheit, die insbesondere in Malariagebieten wie Ägypten vorkomme und zudem ähnliche Befunde wie die Köhlersche Knochenkrankheit hervorrufe, teilten Timmann und Meyer mit. Die Sichelzellenkrankheit passe zudem gut zu Tutanchamuns Abstammung aus einer Inzestbeziehung und seinem Tod als junger Erwachsener. Todesfälle in Folge von Malaria träten nach Erfahrung von Tropenmedizinern dagegen meist im Kindesalter auf, später nur noch sehr selten. Zur endgültigen Klärung der Todesursache sollten deshalb weitere DNA-Tests an der Mumie Tutanchamuns veranlasst werden.