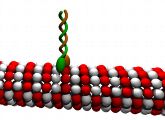Wochenrückblick KW 33
Übervolle Eisenspeicher bei Parkinson-Kranken
Nervenzellen speichern im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung gezielt Eisen, an dem sie schließlich zugrunde gehen.
Bei der Parkinson-Krankheit sterben im Gehirn bevorzugt die Nervenzellen der sogenannten Substantia Nigra ab. Die „dunkle Substanz“ heißt so, weil einige Zellen in ihr den Farbstoff Neuromelanin enthalten. Diese Zellen stellen nicht nur den wichtigen Botenstoff Dopamin her, sondern sammeln im Verlauf einer Parkinson-Erkrankung auch vermehrt Eisen an. Auf der Suche nach den Zusammenhängen dieses Vorgangs haben Forscher um Katrin Marcus von der Ruhr-Universität Bochum gemeinsam mit Münchner und Würzburger Kollegen jetzt einen wichtigen Fund gemacht. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Molecular & Cellular Proteomics (Ausg. 8, 2009, S. 1832-1838) berichten, entdeckten sie in den Neuromelanin-Körnchen ein Eiweiß, das als Eisenspeicher dient.
Dass Neuromelanin Eisenionen bindet, war schon bekannt. Allerdings führt das in der Zelle zur vermehrten Bildung von zellschädlichen freien Radikalen. Deshalb sind die eisenbindenden Nervenzellen der Substantia Nigra die ersten Opfer einer Parkinson-Erkrankung. Sie gehen an einer Überdosis Eisen zugrunde.
Die neuen Forschungsergebnisse suggerieren jedoch, dass das Absterben der Dopamin-produzierenden Zellen keine zufälligen Kollateralschäden sind, sondern dass sie ganz gezielt Eisen aus dem Stoffwechsel fischen. In den Neuromelanin-Körnchen entdeckten die Forscher nämlich Ferritin. Dieses wichtige Eisenspeicher-Eiweiß war bisher im menschlichen Gehirn nur in Stützzellen (Gliazellen) nachgewiesen worden, nicht aber in Nervenzellen.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
News: Experten warnen vor Stammzell-Therapie gegen Parkinson |
"Das Ferritin in den Neuromelanin-Granula ist unseres Erachtens ein weiterer wichtiger Bestandteil der Eisen-Selbstregulation in der Substantia Nigra", sagt Katrin Marcus. "Dieser erste direkte Nachweis von Ferritin in den Neuromelanin-Granula der dopaminergen Nervenzellen ist ein wichtiger Schritt in Richtung eines verbesserten Verständnisses des Eisenstoffwechsels der menschlichen Substantia Nigra und liefert Argumente für neue Hypothesen, die die Mechanismen der Eisen-gesteuerten Degeneration der Substantia Nigra bei der Parkinson-Krankheit betreffen." Nun sollen weitere offene Fragen geklärt werden, etwa warum nur die Neuromelanin-Zellen und nicht alle Zellen der Substantia Nigra bei Parkinson zugrundegehen. Die Arbeiten wurden unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung innerhalb der Programme NGFN2 und NGFNplus unterstützt.
Neue Pflanzenarten durch Genom-Vervielfältigung
Eine Vervielfältigung des Chromosomensatzes ("Polyploidie") trägt bei Farn- und Blütenpflanzen rund viermal häufiger zur Entstehung neuer Arten bei als bislang angenommen.
Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein Wissenschaftler der Universität Münster gemeinsam mit Kollegen aus den USA und Kanada durchgeführt hat. Mit "Polyploidie" bezeichnen Biologen eine vererbbare Erhöhung der Anzahl von Kopien des Genoms. Jedes Chromosom, also jede Einheit des Genoms, liegt dann in den Zellen statt wie üblich in zwei Kopien mindestens dreimal vor.
Während dieses Phänomen im Tierreich nur selten vorkommt, ist es bei Pflanzen häufig. Oft treten durch diese Vervielfältigung neue Merkmale auf, so dass neue Formen der Pflanze und schließlich neue Arten entstehen können. Viele Nutzpflanzen wie Weizen, Mais oder Kartoffeln sind polyploid und dadurch ertragreicher als die Wildformen.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
Förderbeispiel: GABI: Ein tiefer Blick ins Gen-Bouquet der Pflanzen |
Für ihre Untersuchung, die im Fachblatt Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (Online-Vorabveröffentlichung, 10. August 2009) veröffentlicht wurde, haben die Wissenschaftler vorhandene genetische Daten von mehr als 28.000 Gefäßpflanzenarten (Farn- und Blütenpflanzen) verglichen und rund 2.000 Artbildungsereignisse untersucht. Bei Blütenpflanzen ist die Entstehung neuer Arten in 15 Prozent der Ereignisse mit einer Erhöhung der Anzahl der Genom-Kopien verbunden. Bei Farnen sind es sogar 31 Prozent. Rund 35 Prozent der untersuchten Arten sind polyploid. "Die Entstehung neuer Arten durch das Auftreten von Polyploidie ist bei Gefäßpflanzen viel häufiger als bislang angenommen", sagt Troy Wood vom Institut für Evolution und Biodiversität der Universität Münster, der federführend an der Studie beteiligt war.
"Pünktlich zum Darwin-Jahr ist es uns gelungen, das Geheimnis des Ursprungs eines großen Teils der Artenvielfalt bei Pflanzen zu erklären." Die Studie zeigt auch, dass Pflanzen, die einen vervielfältigten Chromosomensatz haben, nicht mehr neue Arten hervorbringen als ihre engen Verwandten mit einem einfachen oder weniger stark vervielfältigten Chromosomensatz. Wood sagt dazu: "Das ist auch ein wichtiges Ergebnis. Viele Botaniker sehen in dem Auftreten von Polyploidie eine Anpassung, die mit einem evolutionären Vorteil verbunden ist. Unsere Untersuchung legt nahe, dass dies nicht unbedingt der Fall sein muss."
Universalschalter in der Zelle gefunden
Wissenschaftler aus München und Kopenhagen haben einen Generalschalter für Eiweiße in der Zelle gefunden.
Die Steuerung zellulärer Prozesse läuft nicht nur über das Auslesen von Genen und die Produktion von Eiweißen, sondern auch über nachträgliche Veränderungen bereits vorhandener Eiweiße. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biochemie in Martinsried und der Universität Kopenhagen konnten nun zeigen, dass das Anhängen von Acetylgruppen (Essigsäureresten) praktisch alle Lebensbereiche der menschlichen Zelle beeinflusst und eine viel größere Bedeutung hat als bisher vermutet.
Ob Zellteilung, Signalübertragung oder Alterungsprozesse - überall spielen Acetylgruppen als molekulare Schalter eine Rolle, wie die Forscher im Fachmagazin Science (Vol. 325, Ausg. 5942, S. 834-840) berichten. Dies macht die beteiligten Moleküle auch zu einem wichtigen Ziel für die Entwicklung neuer Medikamente gegen Erkrankungen wie Krebs, Alzheimer und Parkinson.
| Max-Planck-Institut für Biochemie |
Im Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried bei München erforschen Wissenschaftler seit 1973 die fundamentalen Bausteine der Zelle. |
Dank einer eigens entwickelten Technologie konnten die Wissenschaftler zum ersten Mal im gesamten Proteinbestand der Zelle nach Schaltstellen suchen, an denen Acetylgruppen andocken können. Insgesamt entdeckten die Forscher mehr als 3.600 Schaltstellen in fast 1.800 Proteinen. Damit ist die Acetylierung viel weiter verbreitet als bisher vermutet wurde. "Wir konnten die Zahl der bekannten Acetylierungsstellen um den Faktor sechs erhöhen und erstmals eine umfassende Einsicht in diese Art der Protein-Modifikation gewinnen", erklärt Matthias Mann, der die Forschungsabteilung "Proteomics und Signaltransduktion" am Max-Planck-Institut für Biochemie leitet.
Früher gingen Wissenschaftler davon aus, dass die Acetylierung von Proteinen vor allem für die Genregulation im Zellkern eine Rolle spielt. Die neuen Ergebnisse zeigen, dass praktisch jeder zelluläre Prozess davon betroffen ist - ohne Acetylierung könnte die Zelle nicht funktionieren. Defekte in der Protein-Regulation tragen zur Entstehung zahlreicher Krankheiten bei, daher ist die Acetylierung ein vielversprechender Ansatzpunkt für die Entwicklung neuer Medikamente. Die Beeinflussung dieses molekularen Schalters ist auch für die Behandlung altersbedingter neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson hilfreich, hoffen die Forscher.
Auf nach Hollywood - Krankheitserreger im Film
Ob Bakterien, Viren oder Parasiten - Krankheitserreger sind nicht nur Objekte intensiver Forschung, sondern mitunter auch Hollywood-Filmstars. Eine Sonderausgabe der Zeitschrift Biotechnology Journal befasst sich mit dem Filmleben der Mikroben.
In "Outbreak - Lautlose Killer" des Regisseurs Wolfgang Petersen aus dem Jahr 1995 bedroht das tödliche, bislang in Afrika heimische Ebola-Virus die USA. Gekonnt wird mit der realen Angst der Menschen vor weltweiten Seuchen gespielt. Die Lösung im Film findet der Wissenschaftler dann eher amüsant: In nur zwei Tagen wird ein Impfstoff entwickelt - normalerweise dauert so etwas mindestens ein halbes Jahr.
"Outbreak" ist nur eines von vielen Beispielen, in denen Filmemacher winzige Bakterien, Viren oder Parasiten zu ihren Hauptdarstellern gemacht haben. Der Heidelberger Malaria-Forscher Friedrich Frischknecht hat in der neuen Ausgabe des "Biotechnology Journals" wissenschaftliche Beiträge von Forschern aus den USA, Kanada, Südafrika und Europa zusammengestellt, die von unterhaltsamen Artikeln zu Infektionskrankheiten in Literatur und Hollywood-Filmen ergänzt werden. Das englischsprachige Sonderheft fasst eine zweitägige wissenschaftliche Konferenz zusammen, die im September 2008 in Heidelberg stattfand. Die Artikel des Hefts können im Internet eingesehen und heruntergeladen werden.
Dabei sehen die Forscher die meist sehr pahantasievolle Verwurstung wissenschaftlicher Themen nicht nur als unzulässige Vereinfachungen. "Gute Unterhaltung kann zu einem besseren Verständnis komplexer Inhalte beitragen", meint Frischknecht. "Im besten Fall motivieren Unterhaltungsmedien interessierte Leser oder Zuschauer dazu, nach weiterführenden Informationen zu suchen." Im besten Fall wird so Grundlagenforschung an ein breites Publikum vermittelt. Wer hätte gedacht, so Frischknecht, dass ein Film über eine Abwehrzelle, die ein Bakterium verfolgt, bereits von 300.000 Internet-Besuchern angeschaut wurde? In diesem Sinne fordert Frischknecht die Kollegen auf, ihr Filmmaterial doch auch auf Video-Plattformen wie YouTube zu veröffentlichen. Damit jeder was von der Wissenschaft hat.
Reibung lässt auch biologische Minimotoren heiß laufen
Auch molekulare Motoren innerhalb der Zelle müssen gegen Reibungskräfte ankämpfen.
Mit Hilfe einer Laserpinzette haben Dresdner Forscher erstmalig direkt Reibungskräfte zwischen einzelnen molekularen Motoren und deren Schienen gemessen. Sie konnten somit zeigen, dass es auch innerhalb der Zellen Reibung gibt - meist ist sie jedoch bei weitem nicht so stark, wie das bei großen Maschinen der Fall ist.
| Mehr zum Thema auf biotechnologie.de |
Wochenrückblick: Muskeleiweiße sind die stärksten Proteine der Natur |
Die Forscher am Biotechnologischen Zentrum (BIOTEC) der TU Dresden und dem Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) haben den Eiweißmotor Kinesin auf Mikrokugeln aufgebracht und diesen mit einer Laserpinzette über einen Mikrotubulus gezogen. Reibung, so die Wissenschaftler im Fachmagazin Science (Vol. 325. Ausg. 5942, S. 870 - 873), entsteht auf molekularer Ebene offenbar durch die Kräfte, die notwendig sind, um die kleinen Haftverbindungen zwischen einzelnen Molekülen auseinanderzureißen.
Die Eiweißmotoren stolpern mit 8-Millionstel-Millimeter-Schritten über ihre Molekülschienen hinweg. "Das ist genau die Länge der Tubulin-Untereinheiten, aus denen sich ein Mikrotubulus aufbaut und an dem so ein Motor entlangläuft - das Motorprotein scheint also mit seinen kleinen Füßchen von Untereinheit zu Untereinheit zu stapfen", so Erik Schäffer, Gruppenleiter am BIOTEC. Die gemessenen Reibungskräfte geben auch Aufschluss über die Effizienz des Eiweißmotors. "Ungefähr die Hälfte der Energie, die Kinesin aus dem Treibstoff ATP der Zelle gewinnt, geht als Reibung zwischen Motor und Untergrund verloren", fasst Howard zusammen. "Was nach den Verlusten im Inneren des Motors von der Energie übrig bleibt, wird in mechanische Arbeit umgesetzt - alles in allem meist effizienter als bei großen Maschinen", fügt Schäffer hinzu. Der Energieverlust wird letztendlich in Wärme umgewandelt, die zum Heizen unseres Körpers beiträgt. So werden auch unsere Muskeln unter anderem durch Reibung warm, wenn sie etwas leisten müssen.
Bremer Wissenschaftler klagt gegen Aus für Affenversuche
Die Bremer Gesundheitsbehörde hat die Versuche mit Affen an der Bremer Universität endgültig abgelehnt. Der Hirnforscher Andreas Kreiter will aber nicht aufgeben und geht in die nächste Instanz. Er kündigte an, beim Verwaltungsgericht zu klagen.
Der Stopp der Versuche am Zentrum für Kognitionswissenschaften, der in zwei Monaten fällig werden könnte, würde zwei vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Verbundprojekte gefährden, teilte die Universität Bremen mit. Kreiter untersucht an den Makaken derzeit die "Raumzeitliche Dynamik kognitiver Prozesse des Säugetiergehirns" und die "Kabellose Erfassung lokaler Feldpotentiale und elektrische Stimulation der Großhirnrinde für medizinische Diagnostik und Neuroprothetik".
| Zentrum für Kognitionswissenschaften |
Im Zentrum arbeiten mehrere Wissenschaftsdisziplinen zusammen. Gemeinsam wollen die Forscher vom Verständnis grundlegender Prozesse in einzelnen Neuronen und Synapsen zur Erforschung komplexer kognitiver Funktionen gelangen. mehr Informationen: hier klicken |
Zu den Versuchen an Makaken gebe es in der Hirnforschung derzeit keine Alternative, betont die Universität in einer Stellungnahme (hier abzurufen). Außerdem habe man sich in den vergangenen zwölf Jahren immer "penibel" an das Tierschutzgesetz gehalten. Uni-Präsident Wilfried Müller gibt sich kämpferisch. "Die Universität Bremen wird alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen - bis hin zum Gang vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe."
Andreas Kreiter hatte im Frühjahr 2008 bei der zuständigen Bremer Gesundheitsbehörde einen Antrag zur Fortführung der Forschungsarbeiten mit Makaken gestellt. Seit 1997 laufen die Versuche an Affen in Bremen, bisher wurde die Erlaubnis alle drei Jahre bestätigt. 2008 lehnte die Gesundheitsbehörde überraschend ab. Kreiter erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung, mit der die wissenschaftliche Arbeit mit den Tieren bisher fortgesetzt werden konnte. Jetzt müssen die Verwaltungsrichter entscheiden.
In dem Widerspruchsbescheid bekräftigt die Bremer Gesundheitsbehörde ihre Auffassung, dass die Versuche „ethisch nicht vertretbar“ seien. Nach Angaben eines Sprechers wurde abgewogen zwischen Tierschutz und Forschungsfreiheit. Es sei unsicher, ob die Experimente tatsächlich den erhofften „für die Allgemeinheit spürbaren Nutzen“ brächten. Die Behörde sieht damit die Belastungen für die Tiere nicht mehr gerechtfertigt.